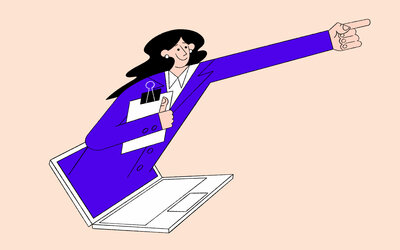Im Herbst 2025 steht in der Schweiz eine wegweisende steuerpolitische Entscheidung an: Das Stimmvolk wird darüber befinden, ob der sogenannte Eigenmietwert abgeschafft werden soll. Diese Abstimmung ist das Resultat langjähriger politischer Diskussionen und Reformbemühungen. Im Dezember 2024 haben National- und Ständerat einem grundlegenden Systemwechsel zugestimmt: Die Besteuerung des Eigenmietwerts soll für alle selbstgenutzten Wohnimmobilien entfallen. Parallel soll den Kantonen die Kompetenz zugesprochen werden, für überwiegend selbstgenutzte Zweitliegenschaften eine sogenannte kantonale Objektsteuer einführen zu können. Die Abschaffung des Eigenmietwerts und die Möglichkeit zur Einführung einer kantonalen Objektsteuer für Zweitliegenschaften sind aneinandergekoppelt. Weil zur Ermöglichung dieser Objektsteuer die Bundesverfassung geändert werden muss, liegt der Entscheid nun bei Volk und Ständen. Sagen die Mehrheiten von Stimmvolk und Kantonen Ja zur Ermöglichung der genannten Objektsteuer, bedeutet dieses Ja gleichzeitig auch das Ja zur Abschaffung des Eigenmietwerts. In diesem Artikel werfen wir einen Blick zurück auf die Ursprünge des Eigenmietwerts, verfolgen seine Entwicklung und stellen die Frage nach seiner heutigen Berechtigung.
Der Eigenmietwert in Kürze
Immobilieneigentümer, die ihre Liegenschaft selbst bewohnen, müssen den sogenannten Eigenmietwert als «fiktives Einkommen» versteuern. Ihr Eigenmietwert leitet sich ab aus dem Betrag, den sie bei Vermietung der Liegenschaft an Dritte erzielen könnten. Offizielle Begründung: Mit der Selbstnutzung des Eigentums fallen die Ausgaben weg, die ansonsten als Mietzinse berappt werden müssten – und der wesentliche Teil dieser ersparten Ausgaben wird in der Form eines «fiktiven Einkommens» als steuerpflichtig erfasst. Erklärt man diese Praxis im Ausland, erntet man zumeist irritierte Blicke. Wer seine eigenen vier Wände bewohnt, muss dafür einen fiktiven Mietzinsertrag versteuern? Das tönt nicht nur unlogisch, sondern ist schlicht absurd – und findet sich in dieser Form auch in keinem anderen Land.
Von der Krisenabgabe zur Wohneigentums-Strafe
Als Grund für die Besteuerung des Eigenmietwerts wird heute meistens die «Gleichbehandlung» von Mietern und Hauseigentümern angeführt. Mieter könnten ihre Miete schliesslich nicht von der Steuer abziehen, deshalb müsste diese den selbstnutzenden Eigentümern eben «fiktiv» aufgerechnet werden. Das tönt nicht schlecht, entspricht aber nicht der Wahrheit. Der Ursprung der Besteuerung des Eigenmietwerts liegt ganz woanders: 1915 stimmten Volk und Stände einer einmaligen eidgenössischen Kriegssteuer mitsamt einer «fiktiven Eigenmiete» zu. Diese Steuer sollte die finanziellen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf den Bundeshaushalt abmildern.
Ab 1929 entstand aufgrund der Weltwirtschaftskrise erneut ein erheblicher Finanzbedarf. Daher wurde ab 1934 eine neue eidgenössische Krisenabgabe fällig, wieder inklusive Eigenmietwert. Nachdem diese Krisenabgabe zunächst auf vier Jahre beschränkt war, wurde sie immer und immer wieder verlängert und letztlich ins ordentliche Recht überführt. Diese Krisenabgabe ist ein Paradebeispiel dafür, wie schnell neue Steuern eingeführt werden können – und wie einfach, still und leise danach aus einer befristeten Abgabe zur Bewältigung finanzieller Engpässe in Krisenzeiten eine mittlerweile 90-jährige Steuerbelastung für Hauseigentümer wurde. Die heute gerne als Grund geltend gemachte Steuergerechtigkeit hatte mit der Einführung der Besteuerung des Eigenmietwerts folglich gar nichts zu tun und war nie der wahre Grund für diese Art der Besteuerung von selbstgenutztem Wohneigentum.
Ungerechte Differenzierung der Vermögenswerte
Hinzu kommt, dass die Besteuerung einer solchen Eigennutzung ausschliesslich bei selbstgenutztem Wohneigentum erfolgt, nicht aber bei anderen Vermögenswerten. Diese unterliegen lediglich der Vermögenssteuer, nicht jedoch zusätzlich der Besteuerung der Eigennutzung. Andere Vermögenswerte wie zum Beispiel Fahrzeuge oder Boote können vom Eigentümer genutzt werden, ohne dass darauf eine Nutzungssteuer fällig wird. Besonders augenfällig ist diese Diskrepanz bei Hausbooten und Wohnwagen: Obwohl diese ebenso dem Wohnen dienen können, fällt für sie kein fiktiver Eigenmietwert an.
Schuldzinsabzug ist kein Privileg der Wohneigentümer
Eine im Zusammenhang mit der Besteuerung des Eigenmietwerts oft erwähnte Begründung für diese Steuer lautet, dass im Gegenzug doch die Hypothekar-Schuldzinsen in Abzug gebracht werden dürfen. Die Steuerlast sei demnach gar nicht so gross. Es ist jedoch nicht mehr als korrekt, dass Immobilieneigentümer die Hypothekar-Schuldzinsen vom steuerbaren Einkommen (inklusive Eigenmietwert) in Abzug bringen dürfen. Denn das dürfen nicht nur sie, sondern alle Steuerpflichtigen. Der Abzug von privaten Schuldzinsen ist somit kein Sonderprivileg für Immobilieneigentümer, der die zusätzliche Steuerlast durch die «Eigenmiete» rechtfertigen würde. Vielmehr ist es eine logische Konsequenz in unserem Steuerrecht.
Wie auch von vielen anderen Abzügen im schweizerischen Steuerrecht können alle Steuerpflichtigen von diesem Abzug Gebrauch machen, nicht nur selbstnutzende Wohneigentümer. Das entspricht einem der zentralen Grundsätze des schweizerischen Steuerrechts, nämlich dem Prinzip der Besteuerung nach der objektiv messbaren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Demnach müssen alle Aufwendungen, die notwendig sind, um ein steuerbares Einkommen zu erwirtschaften, wiederum vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden dürfen. Allgemeine Beispiele im schweizerischen Steuerrecht sind die Abzüge für den Arbeitsweg, für die Mehrkosten bei auswärtiger Verpflegung und für übrige Berufsauslagen. Diese Abzüge stehen im Zusammenhang mit der Erzielung eines steuerbaren Einkommens – dem Lohn aus der Erwerbstätigkeit. Ebenfalls dazu gehört der oft erwähnte Abzug für Schuldzinsen – bei Immobilieneigentümern sind das in der Regel die Hypothekarzinsen für die Immobilien, die sie selbst bewohnen (und im Gegenzug den Eigenmietwert versteuern müssen) oder vermieten (und im Gegenzug die Mieteinnahmen versteuern müssen).
Art. 33 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG) und Art. 9 des Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) statuieren klar, dass heute alle Steuerpflichtigen private Schuldzinsen bis zur Höhe der steuerbaren Vermögenserträge und zuzüglich bis weitere 50 000 Franken vom steuerbaren Einkommen abziehen können. Wer also beispielweise einen Kredit aufnimmt, um ein Boot, ein Auto, einen Wohnwagen oder Konsumgüter zu finanzieren, kann die anfallenden Schuldzinsen steuerlich geltend machen. Gleichzeitig müssen die Eigentümer solche Vermögenswerte aber lediglich als Vermögen deklarieren – für den privaten Gebrauch eines Autos, Bootes oder Wohnwagens wird kein fiktiver Eigennutzwert erhoben. Die Besteuerung des Eigenmietwerts bei selbstgenutztem Wohneigentum stellt somit eine steuerliche Ungleichbehandlung dar. Sie trifft ausschliesslich selbstgenutztes Wohneigentum. Und dies nicht aufgrund von Steuergerechtigkeit, sondern aufgrund von fiskalischen Begehrlichkeiten des Staates. HEV Schweiz
«1915 stimmten Volk und Stände einer einmaligen eidgenössischen Kriegssteuer mitsamt einer fiktiven Eigenmiete zu. Diese Steuer sollte die finanziellen Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf den Bundeshaushalt abmildern.»