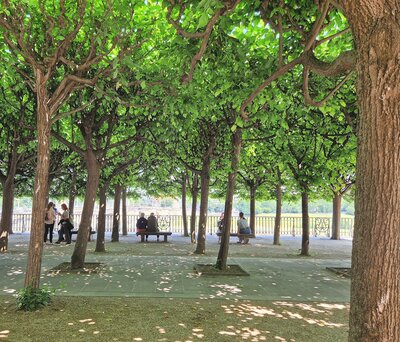«In der letzten Eiszeit lag die Landschaft hier im Puschlav unter einer 1000 Meter mächtigen Eisdecke. Sie überdeckte die Alpen komplett.» So beschreibt Guide Roberto Ferrari die Umgebung des Piz Palü vor 25 000 Jahren. Er hat uns vom Bahnhof Cavaglia abgeholt und geht nun mit energischen Schritten neben uns her, immer entlang des renaturierten Bergbachs Cavagliasch, der frei über breite Schwemmflächen in den Wiesen neben uns mäandert. Roberto Ferraris Blick schweift über die uns umgebenden Berge. Er spricht von Eismengen, die das Vorstellungsvermögen vollkommen übersteigen. Noch schwieriger ist der Versuch, sich die Massen an Wasser auszumalen, die in den folgenden 10 000 Jahren beim Abschmelzen des Eises abgeflossen sein müssen.
Über dem Berninagebiet hatte sich ein Eisdom gebildet, dessen höchste Stelle etwa bei der Engadiner Hochebene im Raum der Ortschaft Samedan lag. Die Gletscherzungen flossen von dort in alle Himmelsrichtungen ab und reichten bis weit in die heutigen Alpentäler hinein. Ihre gewaltige Erosionskraft formte die Landschaft, die wir heute kennen.
Eben diesen gewaltigen Eismassen verdankt die Region hier oben eine ganz besondere Attraktion: den Gletschergarten im Süden der Cavaglia-Ebene bei der Moti da Cavagliola. Dorthin ist Ferrari gerade mit uns unterwegs. Hier gibt es eine Besonderheit, die man in derartiger Dichte kaum irgendwo zu sehen bekommt: Gletschertöpfe. Jeweils gleich mehrere Meter tief. Man muss sich weit über das Geländer beugen, um auf ihren Grund zu sehen.
100 pro Quadratkilometer
«Wir haben hier gut 100 Gletschertöpfe auf einem einzigen Quadratkilometer. Der Gletschergarten ist einer der wenigen Orte in Europa, wo sie derart gut erschlossen sind», erläutert Ferrari. Sie sind in dieser Tiefe selten im Alpenraum. Noch sind längst nicht alle Geheimnisse ihrer Entstehung gelüftet. Es gibt die Gletschertöpfe in Cavaglia, Maloja, Chiavenna, Torbole / Garda auch Zermatt hat ähnliche.
Gemeinsam ist all diesen Fundstellen, dass sie am Ende einer Ebene auf einem Felsriegel liegen, hinter dem der Fels markant nach unten abfällt. In Cavaglia fällt diese Geländestufe bis San Carlo steil um circa 600 Meter ab. Das war zu viel für das starre Gletschereis. Wenn der Gletscher an die Kante traf, bildeten sich mächtige Spalten im Eis. Durch diese ergossen sich Schmelzwasserströme auf das darunter liegende Gestein. «Eingequetscht zwischen den darüber liegenden Eismassen und dem felsigen Grund floss das Wasser unter hohem Druck mit enormer Geschwindigkeit. Dabei führte es Gesteinsmehl und Geröll mit sich. An Geländeunebenheiten entwickelte sich daraus eine gewaltige Sandstrahlwirkung.» Steine und Wasser frästen Löcher in den Untergrund und arbeitete sich mit Macht weiter in die Tiefe. So bildeten sich die Gletschertöpfe.
Noch heute kann man nachvollziehen, dass sie entlang von Klüften entstanden, in die Schmelzwasser stürzte: Die Töpfe im Gletschergarten liegen in mehreren Gruppen fast linienförmig aufgereiht – und das stets quer zur Fliessrichtung des ehemaligen Gletschers.
Schlamm und Geröll schaufeln
«Die Töpfe waren alsbald mit Schlamm und Geröll aufgefüllt. Daher sind sie heute unsichtbar», erklärt Ferrari. Jeder einzelne der Gletschertöpfe, der sich beim Rundgang im Gletschergarten so eindrücklich aufreiht, wurde von Freiwilligen im Allgemeinen, von Vereinen und vom Zivilschutz in wochenlanger Schufterei von Hand leer geschaufelt.
Den ersten Versuch, einen der Töpfe freizulegen, unternahmen Pfadfinder Anfang der 1970er-Jahre. Der Aufwand war grösser als gedacht, und irgendwann übernahmen die Lernenden der Rhätischen Bahn. 1994 hatten sie den ersten Gletschertopf vollständig geleert. Das Ergebnis war so eindrücklich, dass das didaktische und touristische Potenzial, das darin steckte, nicht mehr zu übersehen war. So wurde Topf um Topf in zahllosen Stunden mit Schaufeln, Pickeln und Eimern an Seilwinden von Schlamm und Geröll befreit. Schliesslich hatte man stattliche 32 Töpfe ausgeschaufelt.
Zwischen 1994 und 2010 wurde gegraben, und es wurden Geländer um die Gletschertöpfe errichtet, Wege angelegt, die malerisch über Felsbuckel und entlang kleiner Moore führen. Jeder einzelne Topf wurde genau vermessen und seine Daten auf einem Schildchen daneben eingraviert. Ferrari hat nachgerechnet: «Im Gletschergarten stecken etwa 250 000 freiwillige Arbeitsstunden.»
Spuren lesen
Wie hat man die Töpfe aber überhaupt gefunden, wenn sie doch aufgefüllt und längst überdeckt waren? Die Antwort ist ganz einfach: «Das Wasser darin fliesst nicht ab. Daher wachsen an diesen Orten Pflanzen, die es nass und moorig brauchen. Finden wir Scheuchzers Wollgras und Braunsegge, so wissen wir, dass wir dort nachsehen sollten», so Ferrari weiter.
Unterhaltsarbeiten gibt es bis heute zu leisten. Ein Verein stemmt das Ganze über seine Mitgliedsbeiträge und Spenden. Der Eintritt in den Gletschergarten ist daher nach wie vor kostenlos. Die automatische Zählstation zählt 50 000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. Kein Wunder – perfekt freigelegte tiefe Gletschertöpfe wie die in Cavaglia sind eben eine rare Besonderheit.
«Im Gletschergarten in Luzern gibt es natürlich auch welche», erzählt Ferrari abschliessend auf dem Rückweg zum Bahnhof, «die sind aber, wie die meisten ihrer Art, flach und breit wie ein Spiegelei. Unsere sind schmal und eindrücklich tief.» Bis zu 15 Meter reichen manche in den Fels hinunter. Eine Rarität. Kein Wunder, dass man die Gletschertöpfe im Puschlav «Marmitte dei Giganti» nennt – die Töpfe der Riesen.
Gletschertopf statt Gletschermühle
Gletschertöpfe werden durch Verwirbelungen von Schmelzwasser unter dem Gletscher gebildet, das sich durch seinen Sand- und Geröllgehalt mit Macht in die Tiefe fräst, ähnlich wie beim Sandstrahlen.
Viele haben in der Schule noch den Begriff «Gletschermühle» für dieses Phänomen gelernt. Dieser wird nicht mehr benutzt, da er auf einer veralteten, längst widerlegten Theorie fusst. Die Theorie entstand, weil auf dem Grund der Gletschertöpfe häufig grössere, durch die Erosionskraft gerundete Steine gefunden wurden. Man nahm an, dass diese Steine, vom Wasser immer weiter bewegt, über Jahrhunderte die Töpfe ausgemahlen hätten.
Heute weiss man, dass sie an der Entstehung nicht beteiligt waren. Sie fielen vermutlich zufällig in den mehr oder weniger fast fertigen Topf. Hätten sie die tiefen Löcher tatsächlich ausgemahlen, wären sie durch den hohen Wasserdruck zerbrochen und selbst zermahlen worden. Manche Wissenschaftler meinen heute, dass wegen des hohen Drucks, den das Wasser auf den Untergrund ausübte, teils ein einziger Sommer genügt haben könnte, um die Töpfe derart tief auszumahlen.
Der Gletschergarten von Cavaglia
Der Gletschergarten befindet sich am Fuss des Berninamassivs und des Piz Palü. Die schönste Anreisevariante ist eine Fahrt mit der Berninalinie der Rhätischen Bahn, längst UNESCO-Weltkulturerbe. Die Strecke führt durch die spektakuläre Landschaft mit ihren tosenden Wasserfällen zur Bahnstation Cavaglia (1693 m.ü.M).
Zusatztipp: Schluchtweg nicht verpassen
Wer schon dort ist, sollte sich auch noch Zeit für den 2021 neu geschaffenen Schluchtweg mit seinen tosenden Wassermassen nehmen. Er schliesst direkt an den Gletschergarten an. Weitere Gletschertöpfe, Strudelhöhlen und teils fast bizarre Erosionsformen lohnen den Abstecher.
Der Gletschergarten ist von Mai bis Oktober geöffnet. Zugang gratis, Spenden erbeten. Führungen buchbar unter: ggc.swiss/de