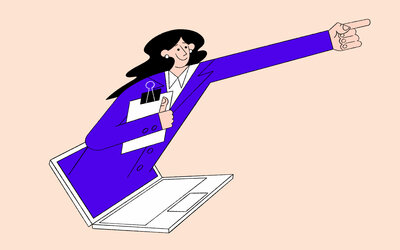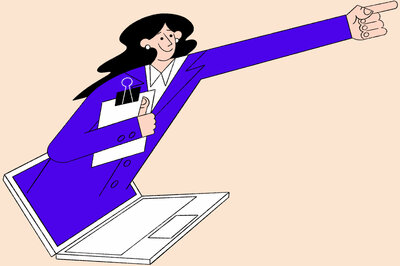Auch am Osterwochenende kam der mediale Blätterwald nicht um das Thema Immobilien und Wohnraum herum. Zu Recht, denn die damit verbundenen Fragen müssen die Schweiz interessieren. Spannend zeigt sich dabei die unterschiedliche Wortwahl. Sie reicht von sachlichen Begriffen wie Wohnungsmangel oder Wohnungsknappheit bis hin zur alarmistisch populistischen Wohnungsnot. Dass von Notstand kaum die Rede sein kann, belegt die Tatsache, dass auch die im letzten Jahr wiederum neu dazugekommenen rund 87 000 Personen in der Schweiz ein Dach über dem Kopf haben.
Unbestritten ist aber, dass der Mangel an Angeboten respektive die hohe Nachfrage nach Wohnraum – insbesondere in den Städten und im urbanen Umland – die Angebotspreise anheizen. Zudem schränkt das seit 2014 in Kraft stehende Raumplanungsgesetz die Bauflächen ein. Neueinzonungen waren einmal, heute lautet das Gebot der Stunde «Verdichtung». Was die Mehrheit des Stimmvolks bei der Abstimmung an der Urne bejahte, will in der Praxis nun fast niemand (zumindest nicht in seiner Nachbarschaft); nämlich enger beieinanderstehende und höhere Wohnbauten. Dazu kommen strengere Bauvorschriften, immer mehr Einsprachen und permanente politische Interventionen. Ersatzneubauten kommen einem Albtraum gleich, entweder wegen Leerkündigungen oder wegen hindernder Unterschutzstellungen. Resultat: Allein in der Stadt Zürich ist der Bau von mehreren Tausend Wohnungen blockiert. Und der Anteil des privaten Wohneigentums nimmt laufend ab.
Unter dem Strich schleckt es keine Geiss weg: Die Produktion von Wohnraum in unserem Land hat mit dem Bevölkerungswachstum nicht Schritt gehalten. Allein zwischen 2018 und 2023 ging die Zahl der baubewilligten Wohneinheiten um rund 30 Prozent zurück. Auf der anderen Seite zeigt der Blick über die letzten dreieinhalb Jahrzehnte ein durchschnittliches Wachstum von jährlich gut 67 000 Personen. Bildlich ausgedrückt ist die Bevölkerung der Schweiz in diesem Zeitraum 35 Mal um alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Lugano gewachsen. Dass ein Ausweg aus diesem Clinch weder in politischer Bauverhinderung noch in staatlicher Vergesellschaftung von Grund und Boden und schon gar nicht in amtlicher Bevormundung oder Regulierungszwängen liegen kann, zeigen uns die abschreckenden Beispiele aus Berlin, Genf und Basel exemplarisch. Es braucht definitiv mehr Wohnraum. An der Bereitschaft dazu fehlt es bei Investoren und Bauwirtschaft nicht. Gerade Zürich könnte einen mutigen Anfang machen, war es doch deren seinerzeitiger Leutpriester Ulrich Zwingli, der sagte: «Tut um Gott’s Willen etwas Tapferes.»