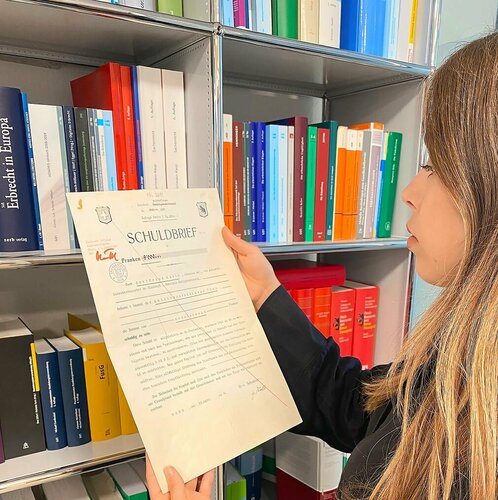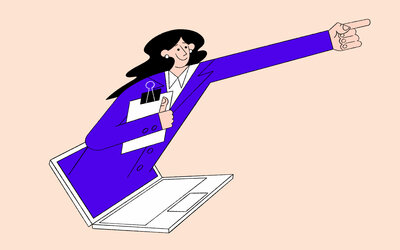Beim verdichteten Bauen gibt es gewisse Infrastrukturen, die von allen Eigentümern gemeinsam genutzt werden. Dazu gehören etwa Wege, Parkplätze, Spielplätze oder Heizanlagen. In solchen Konstellationen können Dienstbarkeiten begründet und im Grundbuch eingetragen werden. Möglich ist jedoch auch – und dies ist Gegenstand dieses Beitrags – die Abparzellierung eines Grundstücks zwecks Erstellung einer solchen (Weg-)Anlage mit anschliessender Zuweisung von Anteilen an die berechtigten Grundeigentümer.
Weggrundstück
Bei einer Überbauung entstehen acht Einfamilienhäuser. Der Zugangsweg als Detailerschliessungsanlage bildet ein separates Grundstück. Die Eigentümer dieser Häuser erstellen, bezahlen, benutzen und unterhalten diesen Weg. Zur rechtlichen Absicherung wird deshalb jedem Eigentümer ein Achtel dieses Weggrundstücks zugewiesen.
Bildung von Miteigentum
Das Weggrundstück wird in Miteigentum aufgeteilt, wobei je ein Achtel mit einem der acht Grundstücke (Einfamilienhäuser) verbunden ist. Der Gesetzgeber spricht in solchen Fällen vom Hauptgrundstück (Einfamilienhaus) und vom unselbstständigen Grundstück (Miteigentumsbeteiligung am Weggrundstück). Letzteres nennt man in der Praxis Anmerkungsgrundstück oder Nebengrundstück. Die erwähnte Verbindung der beiden Grundstücke wird als subjektiv-dingliche Verknüpfung bezeichnet.
Grundbucheintrag
Im Grundbuch wird hier beim Hauptgrundstück in der Rubrik «Anmerkungen» darauf hingewiesen, dass ein Achtel des Anmerkungsgrundstücks dazugehört, ähnlich einem Bestandteil. Andererseits wird beim Anmerkungsgrundstück in der Rubrik «Eigentum» der jeweilige Eigentümer des berechtigten Grundstücks eingetragen, allerdings nicht mit seinem Namen, sondern mit der Grundstücksnummer.
Parkplatzrecht
Auch für Parkplätze eignet sich ein Anmerkungsgrundstück. So kommt es häufig vor, dass der Bauherr eine unterirdische Autoeinstellhalle erstellt, beispielsweise als selbstständiges und dauerndes Baurecht, das im Grundbuch als Grundstück aufgenommen wird. Dieses teilt man alsdann in Miteigentum auf. Es werden so viele Anteile begründet, wie die Anzahl der Einstellplätze. Die einzelnen Miteigentumsanteile weist man den berechtigten Grundeigentümern zu, wobei diese mit dem Grundstück subjektiv-dinglich als Nebengrundstück verknüpft werden.
Pfandsicherheit
Bei der steuerlichen Bewertung des Grundstücks wird das Anmerkungsgrundstück mitberücksichtigt. Dasselbe gilt bei der Vergabe von Hypotheken, da das Anmerkungsgrundstück automatisch mitverpfändet ist, was die Pfandsicherheit erhöht. Wird diese Verknüpfung später vom Eigentümer aufgehoben, muss der Gläubiger der Hypothek zustimmen, da es sich – juristisch betrachtet – um eine Pfandentlassung handelt.
Miteigentümergemeinschaft
Ist das Anmerkungsgrundstück – wie in unserem Beispiel – in Miteigentum aufgeteilt, so bilden die berechtigten Eigentümer eine Miteigentümergemeinschaft. Für die Zuordnung der konkreten Berechtigung sowie für die weiteren Benutzungs- und Verwaltungsbestimmungen kann man ein Reglement erlassen, das sich im Grundbuch anmerken lässt.
Rechtsgrundlage
Die Anmerkungsgrundstücke hatten früher eine untergeordnete Bedeutung. In der Praxis traf man sie etwa bei Rechten an Wasserquellen (Quellenrechten), die zur Speisung mehrerer Bauernhöfe gefasst wurden. Erst mit der Teilrevision des Immobiliarsachenrechts am 1. Januar 2012 regelte man das unselbstständige Eigentum gesetzlich. Die Rechtsgrundlagen für dieses Konstrukt finden sich in Artikel 655 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) und in Artikel 95 der Grundbuchverordnung (GBV).
Grundregeln
Für die Anmerkungsgrundstücke gelten folgende Grundregeln:
● Das Hauptgrundstück und das Anmerkungsgrundstück müssen im Eigentum derselben Person stehen.
● Ein Anmerkungsgrundstück teilt das rechtliche Schicksal des Hauptgrundstücks und kann nicht gesondert veräussert, verpfändet oder belastet werden.
● Die Verpfändung des Hauptgrundstücks umfasst automatisch auch das Anmerkungsgrundstück. Auf dem Anmerkungsgrundstück werden die Grundpfandrechte des Hauptgrundstücks jedoch nicht eingetragen.
● Erfolgt die Verknüpfung zu einem dauernden Zweck, so können weder das gesetzliche Vorkaufsrecht der Miteigentümer (Art. 682 Abs. 1 ZGB) noch der Aufhebungsanspruch (Art. 650 ZGB) geltend gemacht werden.
● Die Verknüpfung kann nur stattfinden, wenn auf dem Anmerkungsgrundstück keine Grundpfandrechte und Grundlasten eingetragen sind.
Fazit
In der Praxis sind Anmerkungsgrundstücke vor allem bei grösseren Überbauungen anzutreffen. Mit dem Hauptgrundstück können dabei nicht nur wie hier Miteigentumsanteile verbunden werden, sondern auch «ganze» Grundstücke, sogar mehrere Grundstücke oder Miteigentumsanteile an mehreren Grundstücken.
Das Hauptgrundstück und das Anmerkungs-
grundstück müssen im Eigentum derselben Person stehen.
Wortlaut des Gesetzes
«1 Ein Grundstück kann mit einem anderen Grundstück derart verknüpft werden, dass der jeweilige Eigentümer des Hauptgrundstücks auch Eigentümer des dazugehörenden Grundstücks ist. Dieses teilt das rechtliche Schicksal des Hauptgrundstücks und kann nicht gesondert veräussert, verpfändet oder belastet werden.
2 Erfolgt die Verknüpfung zu einem dauernden Zweck, so können das gesetzliche Vorkaufsrecht der Miteigentümer und der Aufhebungsanspruch nicht geltend gemacht werden.»
Art. 655a Zivilgesetzbuch