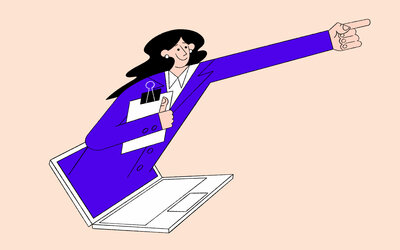In Zürich dürfen voraussichtlich ab Herbst 2026 beziehungsweise im Verlauf von 2027 nur noch elektronisch betriebene Laubbläser genutzt werden, und das auch nur in den Monaten Oktober bis Dezember. In allen anderen Monaten ist ihr Einsatz nur mit einer Ausnahmebewilligung der Stadtpolizei Zürich möglich. Genf hat ein ähnliches Reglement: Hier ist der Einsatz von Laubbläsern nur vom 1. Oktober bis zum 31. Januar erlaubt.
Akkugeräte auf dem Vormarsch
Benzinbetriebene Laubbläser und Laubsauger können einen Schallleistungspegel von bis zu 110 dB(A) erreichen – das entspricht in etwa dem Lärm eines Presslufthammers. Allerdings haben gerade in der professionellen Gartenpflege die akkubetriebenen Geräte die benzinbetriebenen Laubbläser längst ersetzt. Deren Lautstärke liegt bei etwa 80 dB, womit sie so laut wie eine stark befahrene Strasse und deutlich leiser als die benzinbetriebenen sind. Akku-Laubbläser stossen keine schädlichen Abgase wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid aus, was sie im Gegensatz zu Benzinern deutlich umweltfreundlicher macht. Dank des Wechselakkus lassen sich mit der gleichen Stromquelle auch Kettensägen, Rasentrimmer oder andere Geräte bedienen. Der Nachteil der Akkugeräte: Die Laufzeit und Lebensdauer der Batterien sind begrenzt.
Was spricht für den Einsatz der Laubbläser?
Der Lärm ist nicht der einzige Streitpunkt, wenn es um die Vor- und Nachteile von Laubbläsern und -saugern geht. Das Hauptargument der Verfechter ist das Sparpotenzial. Das Herbstlaub mit etwa 250 km/h einfach wegzublasen, mache herbstliche Reinigungsarbeiten effizienter und münde in grosser Arbeitsersparnis – für die öffentliche Hand gehen Schätzungen von einer Einsparung von 80 bis 90 Prozent aus, was den Einsatz von Kehrmaschinen und Handarbeit anbelangt. Andere Schätzungen nehmen, je nach Ausgangssituation, Einsparungen von 25 – 75 Prozent der Arbeitskosten an. Auch dass mit den Geräten unzugängliche Bereiche, beispielsweise mit Fahrzeugen belegte Parkplätze, erreicht werden können, wird als Vorteil genannt. Und da ein Laubbläser das Laub rückenschonend und quasi auf Knopfdruck entfernt, bedarf es weniger Körpereinsatz als das händische Entfernen des Herbstlaubs mit dem Besen oder Rechen. Laubsauger – hier werden die Blätter nicht davongeweht, sondern in einem Auffangbehälter gesammelt – punkten zudem damit, dass gerade an einem windigen Herbsttag die zusammengefegten Blätter nicht zerstieben, sondern sofort zentral gesammelt werden. Einmal saugen, Problem gelöst. Allerdings kommt die Option Laubsauger eigentlich nur dort infrage, wo wenig Laub ein Störfaktor ist, denn der Sack ist im Nu gefüllt – und das ständige Entleeren wirkt sich wieder negativ auf den Zeitaufwand aus.
Problematik: Feinstaub, Pollen, Pilzkeime
Nicht nur in Zürich sind Laubbläser unerwünscht. Städte wie Graz haben sie aufgrund der Feinstaubbelastung schon 2014 verboten. Die TU München hat die Feinstaubbelastung der Laubbläser untersucht: Die Geräte wirbelten zehn Mal so viele Partikel auf wie ein Rechen. Das können Feinstaub, Pollen, Pilzkeime und getrockneter Tierkot sein. Der aufgewirbelte Staub und die Pilzkeime können Allergien und Asthmaanfälle auslösen und die Atemwege belasten. Das hat nicht nur für die Nutzer negative Auswirkungen, sondern ist auch für Allergiker oder empfindliche Personen gesundheitlich bedenklich.
Beeinträchtigung der Biodiversität
Bedenklich sind auch die Auswirkungen der Geräte auf die Tierwelt. Bei einer Luftgeschwindigkeit von 250 km/h wird alles, was auf dem Boden lebt, in Mitleidenschaft gezogen: Frösche, Spinnen, Regenwürmer, Asseln, Insekten. Der Wucht des Luftstroms können sie sich nicht widersetzen – wenn sie nicht gleich bei einem Gerät mit Häckselfunktion eingesaugt und in Kleinteile zerteilt werden. Auch für grössere Tiere wie beispielsweise Igel sind die Geräte eine Gefahr, denn der Lärm kann sie aus dem Winterschlaf wecken – wenn sie in den aufgeräumten Gärten überhaupt noch einen Laubhaufen gefunden haben, der ihnen Unterschlupf bietet. Als oberflächliche Streuschicht ist Laub ein essenzieller Lebensraum für viele Bodentiere – überdies schützt es den Boden vor dem Austrocknen. Genau deswegen, weil sie Bodenlebewesen und Rückzugsorte zerstören, sind Laubbläser aus Sicht des Natur- und Artenschutzes unvertretbar.
Was ist im Endeffekt die beste Lösung?
Akku-Laubsauger und -bläser sind inzwischen auch für Privathaushalte erschwinglich. Auf kleinen oder mittelgrossen Grundstücken bringt ihr Einsatz jedoch kaum Zeitgewinn – feuchtes Laub bleibt oft liegen, speziell auf Strassen und Gehwegen. Gleiches gilt bei sehr verwinkelten Grundstücken oder fehlender Bedienkompetenz. Wo es um Ruhe, Bodenschonung und Artenvielfalt geht, sind Besen und Rechen die bessere Wahl. Sie verbrauchen kein Benzin und keinen Strom, sind leichter, ungefährlich für Boden und tierische Gartenbewohner – und verursachen keinen Lärm. Dass sie für mehr Bewegung an der frischen Luft sorgen, kommt als positiver Effekt hinzu. In grossen Parks, Stadien und öffentlichen Anlagen können Akku-Laubbläser wirtschaftlich sinnvoll sein – wenn sie umsichtig eingesetzt werden.