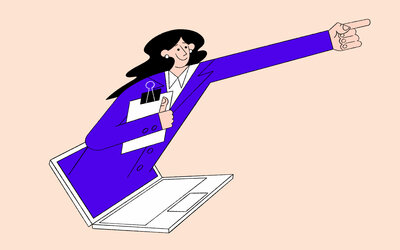Wohneigentum macht seine Besitzer glücklich und nützt der Gesellschaft. Wohneigentümer sind auf lokaler Ebene politisch und sozial stärker engagiert, weil Wohneigentum sesshaft macht, die Identifikation fördert und sich die Qualität der Politik und die Standortattraktivität in den Immobilienwerten niederschlagen. Unsere Forschung (mit David Stadelmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth) mit Daten aller Zürcher Gemeinden zeigt: Je höher der Immobilieneigentümeranteil und je tiefer der Mieteranteil an den Einwohnern ist, desto nachhaltiger ist die lokale Finanzpolitik. Die öffentlichen Mittel werden sparsamer verwendet, und die Verschuldung ist kleiner. Immobilieneigentum ist also ein Protektor der zukünftigen Generationen. Hingegen sind die oft bemühten internationalen Studien, die besagen, dass Immobilieneigentum die Arbeitslosigkeit erhöhen kann, weil Eigentümer seltener sehr weit entfernte Jobs annehmen, für die Schweiz mit ihrem flexiblen Arbeitsmarkt und den kurzen Wegen irrelevant. Vielmehr kann sich hier der so positive Engagement-Effekt des Wohneigentums besonders gut entfalten – dank der direkten Demokratie, des kleinräumigen Föderalismus und des Milizprinzips.
Trotz dieser positiven gesellschaftlichen Wirkungen werden Hauseigentümer nicht gefördert, sondern bisher durch den Eigenmietwert überbesteuert. Der Standardeinwand, der Eigenmietwert diene der Gleichbehandlung von selbstgenutztem Wohneigentum und vermieteten Immobilien sowie Finanzanlagen, ist aus vier Gründen hinfällig:
● Die Besteuerung des Eigenmietwerts ist heute zu hoch, weil die zulässigen Abzüge zu niedrig sind. Heute ist nur der Unterhaltsaufwand abziehbar – aber keine Abschreibungen auf dem Gebäudewert. Real verlieren die Gebäude trotz Unterhalt jährlich rund zwei Prozent an Wert. Entsprechend werden viele nach 40 bis 50 Jahren abgerissen. Weil sie nicht abgeschrieben sind, entsteht dem Besitzer dadurch ein grosser Verlust. Interessant: Der Staat schreibt seine eigenen Immobilien über 30 Jahre ab.
● Selbstbewohntes Wohneigentum wird heute höher besteuert als Finanzanlagen. Es unterliegt auch noch der Vermögens- und der Grundstückgewinnsteuer. Die Kapitalgewinne auf Finanzanlagen hingegen werden richtigerweise nicht besteuert. Kapitalgewinne spiegeln wie Liegenschaftsgewinne Veränderungen der erwarteten Erträge der Anlage; da diese später sowieso besteuert werden, werden sie durch die Kapitalgewinn- und Liegenschaftsgewinnsteuer in der Regel doppelt besteuert. Die Abschaffung des Eigenmietwerts bringt deshalb nicht weniger, sondern mehr Gleichheit in der Besteuerung von Liegenschaften und Finanzanlagen.
● Die heutige Höhe der Besteuerung von Vermögenserträgen ist die falsche Referenzgrösse für selbstgenutzten Wohnraum. Sie ist aus theoretischer Sicht sowie im internationalen Vergleich zu hoch. In der Schweiz werden die Vermögenserträge wie ein Arbeitseinkommen voll besteuert – und zusätzlich auch die Vermögensbestände. In fast allen anderen Ländern werden die Vermögenserträge nur etwa halb so hoch wie ein Arbeitseinkommen und die Vermögensbestände gar nicht besteuert. Zudem sind die besteuerten nominellen Vermögenserträge grösstenteils kein realer Ertrag, sondern nur eine Kompensation für die Vermögensentwertung durch Inflation. So gelten in vielen Kantonen schon für Nettovermögen ab rund einer Million Franken Steuersätze von 0,8 Prozent. Über rund 75 Jahre betrachtet waren in der Schweiz die Rendite von Bundesobligationen bei drei Prozent und die Inflation und damit der Wertverlust des angelegten Geldes bei zwei Prozent. Tatsächlich blieb also den Anlegern nur ein Prozent reale Rendite. Aber die Steuern müssen sie auf der nominellen Rendite von drei Prozent bezahlen, also dem Dreifachen des tatsächlichen realen Einkommens! Nach Abzug der Einkommenssteuer und erst recht der Vermögenssteuer bleibt ihnen so nur ein beträchtlicher jährlicher Vermögensverlust. Eine ähnliche inflationäre Aufblähung wirkt bei der Liegenschaftsgewinnsteuer und auch beim Eigenmietwert, weil die Ämter bei seiner Berechnung durch die Inflation aufgeblähte Zinssätze verwenden.
● Sodann bringen die bei der Besteuerung des Eigenmietwerts unerlässlichen Unterhaltsabzüge schwerwiegende Verzerrungen. Sie senken die Einkommenssteuern der Eigentümer im Umfang ihrer Grenzsteuersätze von zumeist 30 bis 40 Prozent. Durch die Abgrenzung in abzugs- und nicht abzugsfähige Aufwendungen entstehen riesige Marktverzerrungen. Beispielsweise können heute die Kosten für neue Einbauschränke und Gartenarbeiten zumeist als Unterhaltsaufwendungen abgezogen werden, die Ausgaben für freistehende Schränke und Hausreinigung hingegen nicht. Wenn ein Politiker ein System zur 40-prozentigen Subvention mancher Schreiner- und Gartenarbeiten vorschlagen würde, würde er wohl als verrückt angesehen. Genau das Gleiche bewirkt aber unser heutiges Steuersystem.
Die zur Abstimmung stehende Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwerts ist deshalb für die Eigenheimbesitzer und die gesamte Gesellschaft gut und wichtig. Allerdings geht die vorgesehene Einschränkung der Zinsabzüge zu weit. Natürlich ist es richtig, dass mit dem Eigenmietwert auch die Abzüge auf Schulden zur Finanzierung der Immobilie dahinfallen. Aber für Personen, die neben einer Immobilie noch andere Werte besitzen, sich für deren Finanzierung verschuldet haben und die Erträge auf diesen Werten voll versteuern müssen, sollten natürlich die Schuldzinsen noch absetzbar sein. Die Vorlage ist deshalb eine absolute Minimalvorlage und in keinster Weise ungerecht gegenüber den Mietern. Folglich ist die Vorlage unbedingt anzunehmen: Die Eigenmietwertbesteuerung gehört abgeschafft. Als Nächstes sollten dann die Steuern auf Grundstückgewinnen und Vermögenserträgen grundlegend reformiert werden: Sie sollten nur noch die realen Gewinne und Erträge belasten, also jeweils den Kaufkraftverlust der eingesetzten Mittel durch die Inflation berücksichtigen.
Die Vorlage ist eine absolute Minimalvorlage und in keinster Weise ungerecht gegenüber den Mietern.
Zur Person
Reiner Eichenberger
ist ordentlicher Professor für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg i. Ü. Zudem ist er Forschungsdirektor des Center for Research in Economics, Management and the Arts in Zürich.
Abstimmung vom
Sonntag, 28. September 2025:
Abschaffung der Eigenmietwert-Steuer (Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2024 über die kantonale Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften)
● Einstimmige Parole HEV Schweiz: JA
● Empfehlung Bundesparlament: JA
● Empfehlung Bundesrat: JA